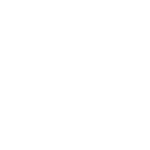20 Jun Wie die Militarisierung Eingang in den Fußball erhält
Wenige Tage vor dem wichtigsten Spiel der Saison verkündete Borussia Dortmund die Zusammenarbeit mit der Rheinmetall AG. Was es bedeutet, dass ein Rüstungskonzern Sportwashing betreibt, wie Dortmund sich die Hände dreckig macht und was jetzt zu tun bleibt.
»Sicherheit und Verteidigung sind elementare Eckpfeiler unserer Demokratie.« Dieser Satz kam nicht etwa aus konservativen Politiker-Reihen und diente der Rechtfertigung, das Budget für Bundeswehr und Polizei aufzustocken. Nein, so äußerte sich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, gegenüber der Presse, anlässlich der Bekanntmachung des neuen Vereins-Sponsors. Die Rheinmetall AG soll über die nächsten drei Jahre circa 20 Millionen Euro an den Fußballclub sponsern – als Gegenleistung wird das Logo des Rüstungskonzerns überall im und um das Stadion herum zu sehen sein. Bekanntgegeben wurde dieser Vertrag mit dem Slogan »taking responsibility« (Verantwortung übernehmen). Das hat die BVB-Geschäftsführung sich anscheinend von der Bundesregierung abgeschaut. Die sagt schließlich auch nicht, dass es ihr bei den Waffenlieferungen an die Ukraine oder der Aufrüstung der Bundeswehr darum geht, die eigenen ökonomischen und politischen Einflussgebiete zu verteidigen, sondern darum, dass Deutschland außenpolitisch endlich wieder »Verantwortung übernimmt«. Eins ist sicher: Die Zeitenwende soll auch im Fußball ankommen. »Gerade heute, da wir jeden Tag erleben, wie die Freiheit in Europa verteidigt werden muss. Mit dieser neuen Normalität sollten wir uns auseinandersetzen«, sagte Watzke. Und das als Stellvertreter einer Branche, deren politische Praxis bisher nicht über die scheinheilige Forderung im letzten Testspiel vor der WM 2022 hinausging, die Menschenrechte in Katar bitte einzuhalten, statt das Turnier konsequent zu blockieren. Dass es sich bei Rheinmetall um einen Rüstungskonzern handelt, dem es egal ist, auf welcher »Seite« er steht, da er am Krieg per sé verdient; der bis 2022 Waffen nach Russland exportiert und ein Übungszentrum für Soldaten vor Ort geplant hat, wurde während der Pressemitteilung unkommentiert gelassen.
Die Reaktionen auf die geplante Partnerschaft fielen unterschiedlich aus: Politiker wie Robert Habeck und Lars Klingbeil beispielsweise äußerten sich positiv. Kein Wunder – denn welch bessere Werbung für den Plan der Kriegsertüchtigung kann es geben als über den Fußball. Die Dortmunder Fanszene hingegen äußerte mit einem Banner im Vorfeld des Champions-League-Finales ihre Kritik an dem Plan der BVB-Bosse, Sportswashing für Rheinmetall zu betreiben. Kurz danach gab übrigens auch der Eishockey-Erstligist Düsseldorfer EG einen Sponsoring-Deal mit dem Rüstungsunternehmen bekannt. Aber sind diese Verträge wirklich so überraschend? Auf der einen Seite haben wir einen Rüstungskonzern, der sein Image aufbessern will. Auf der anderen Seite einen börsennotierten Fußballverein, der aufpassen muss, wie er die nächsten Hochkaräter verpflichtet bekommt oder international den Anschluss nicht verliert. Geld eröffnet da alle Möglichkeiten. Woher dieses kommt, war schon immer zweitrangig.
Die Frage ist jetzt: Was tun? Der strategische Schachzug der BVB-Bosse, das Sponsoring wenige Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu veröffentlichen und damit größeren Protest zu verhindern, ist aufgegangen. Zwar gab es im Vorfeld kritische Stellungnahmen der Fanszene, die das Sponsoring verurteilten und dementierten, es hätte demokratische Abstimmungen der Fans über die Partnerschaft gegeben. Jedoch blieb eine Störung des Finales aus. Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit, den Spielbetrieb in der neuen Saison zu stören und die Geschäftsführung damit zu zwingen, den Deal aufzukündigen. Ähnliches wurde zu Beginn des Jahres durch Fanproteste der Bundesliga-Clubs gegen einen geplanten Investoreneinstieg in den Ligabetrieb erreicht. Minutenlang wurden Spiele unterbrochen, indem die Fans Tennisbälle auf den Rasen warfen oder sogar ferngesteuerte Spielfahrzeuge über den Platz jagten. Der Protest hielt so lange an, bis die DFL, die Deutsche Fußball Liga GmbH, ankündigte, die Gespräche einzustellen. Wirkungsvoll waren diese Aktionen, weil fast alle Fanszenen sich beteiligten und den Spielbetrieb über Wochen immer wieder behinderten. Wie es mit weniger Eskalation funktioniert, haben die Fans des FC Bayern bei Qatar Airways vorgemacht. Das Sponsoring bei Bayern hat dem katarischen Staatsunternehmen viel schlechte Publicity gebracht, so dass sie den Vertrag haben auslaufen lassen. Gerade angesichts der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung der Rüstungsindustrie wäre es wichtig, dass der Widerstand gegen die öffentliche Normalisierung von Konzernen wie Rheinmetall nicht ablässt. Es sollte nicht so laufen wie bei Werder Bremen, als der Schlachter Wiesenhof Trikotsponsor wurde. Als der Deal bekannt wurde, gab es wegen Tierquälerei-Vorwürfen gegen das Unternehmen scharfe Kritik von den Fans und aus der Landespolitik, doch mit der Zeit setzte ein Gewöhnungseffekt ein. Das Sponsoring wurde über Jahre fortgeführt. Wiesenhof finanzierte den Klub von der Weser schließlich bis 2022, ehe ein Bauunternehmen übernahm, dessen Vergangenheit in der NS-Zeit ungeklärt ist. Dass so etwas bei Borussia Dortmund ebenfalls passiert, wäre das Worst-Case-Szenario. Damit es nicht so kommt, muss es den Fußballfans aller Vereine, besonders aber denen des BVB, gelingen, kontinuierlich Druck auf den Verein aufzubauen. Ob ihnen das gelingt, sehen wir in der nächsten Saison.
Ronja und Philipp sind beide im SDS aktiv und träumen von linkeren Fanstrukturen im deutschen Fußball.