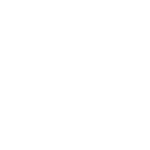07 Jan. Warum der Kampf gegen psychische Probleme ein politischer Kampf sein muss
Die herrschende Psychologie legitimiert durch ihren individualisierenden Blick die gesellschaftlichen Verhältnisse, die psychisches Leid erst verursachen. Als Sozialist*innen sollten wir Depressionen, Ängste & Co. als gesellschaftliches Problem auffassen und es auch als solches bekämpfen. Ein Kommentar von Jan Nellesen.
Psychische Leiden gehören für viele von uns zum Alltag. Immer mehr Menschen leiden unter Depressionen, Ängsten und Süchten. Studierende sind dabei besonders stark betroffen. Glücklicherweise ist das Sprechen über psychische Probleme heute nicht mehr mit einem so starken Tabu behaftet wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Es fällt aber auf, dass psychische Probleme sowohl im psychologischen als auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs in der Regel auf individueller Ebene behandelt werden. Der gesellschaftliche Kontext, in dem sie auftreten, wird meist ausgeblendet.
Aus sozialistischer Sicht sollte klar benannt werden, dass diese Leiden nicht nur das Schicksal einzelner Betroffener sind, das nur durch Medikamente und Therapie behandelt werden kann. Psychische Leiden sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und sollten an der Wurzel bekämpft werden. In einer Gesellschaftsordnung, deren Ziel Profitmaximierung ist und in der die Bedürfnisse der Menschen eine untergeordnete Rolle spielen, ist es klar, dass auch die psychische Gesundheit auf der Strecke bleibt.
Die meisten von uns sind gezwungen, einen Großteil ihrer Lebenszeit der Lohnarbeit zu opfern, deren Sinn häufig nicht erkennbar ist. Abends reichen die Kapazitäten dann oft nicht mehr aus, um erfüllenden Tätigkeiten nachzugehen. In allen Lebensbereichen werden wir unter Konkurrenzdruck gesetzt: egoistisches Verhalten wird belohnt und gegenseitige Hilfe bestraft. Uns wird eingeredet, dass wir alles erreichen könnten, wenn wir nur hart genug dafür arbeiten. In den (sozialen) Medien sehen wir ständig «erfolgreiche» Menschen, an denen wir uns ein Beispiel nehmen sollen. Gleichzeitig wird Armut strukturell zementiert, ökonomischer Aufstieg ist kaum möglich. Viele leiden unter rassistischen, frauen- und queerfeindlichen Ideologien, die strukturell begünstigt werden, weil sie von Ausbeutungsverhältnissen ablenken oder sie legitimieren. Die kapitalistische Produktionsweise verursacht zugleich auf der ganzen Welt ökologische Krisen, Kriege und Katastrophen, die zu massivem Leid führen.
Kapitalistische Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse setzen also fast allen Menschen durch direkte politische und ökonomische Zwänge, durch kulturelle Prägung und in alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen extrem zu. Im psychologischen Diskurs spielt das aber kaum eine Rolle. Die Psychiatrie sieht psychische Leiden als medizinisches Problem an, das im Körper der Betroffenen auftritt und dort bekämpft werden soll. Und auch alle dominanten Strömungen der Psychologie haben einen individualisierenden Blick auf psychische Probleme. In Psychotherapien wird versucht, die Denk- und Verhaltensweisen der Patient*innen zu verändern, während der soziale Kontext als gegeben und unveränderlich vorausgesetzt wird. Diese vorherrschende Herangehensweise an psychische Probleme ist hochpolitisch: sie naturalisiert und legitimiert die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und lenkt vom gesellschaftlichen Sein, das unser Bewusstsein bestimmt, ab.
Sozialist*innen sollten auf den politischen Charakter der Psychologie aufmerksam machen und psychische Leiden auf politischer Ebene bekämpfen. Dazu ist eine fundamentale Kritik der herrschenden Psychologie und Psychiatrie – am besten von innen – notwendig. Die Verbindungen zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und psychischen Leiden sollten öffentlich analysiert und diskutiert werden. Die medikalisierend-individualisierenden Erklärungs- und Behandlungsweisen müssen grundsätzlich hinterfragt werden. Kritische Psycholog*innen wie Klaus Holzkamp und David Smail haben wichtige Vorarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Sozialistische Psycholog*innen sollten ihre Expert*innenposition dazu nutzen, auf die strukturellen Wurzeln psychischer Leiden hinzuweisen. Wir können die Verantwortung für deren Bekämpfung aber nicht auf Psycholog*innen abschieben, die jetzt schon ihr Bestes tun, um Menschen zu helfen. Therapie ist in unserer Gesellschaft in ihren Möglichkeiten stark beschränkt. Für echte psychische Gesundheit brauchen wir eine neue Gesellschaftsordnung, die die Bedürfnisse der Menschen an die erste Stelle setzt und in der alle in ihrer Diversität respektiert werden, ohne sich für Normabweichungen rechtfertigen zu müssen.
Jan studiert Physik und ist in Münster beim SDS und bei einem Lesekreis zu Kritischer Psychologie aktiv.