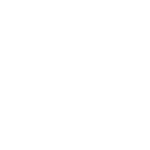03 März Der unerhörte Film
»No Other Land« hat den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Höchste Zeit also, sich den Film, der in Deutschland große Wellen geschlagen hat, einmal genauer anzuschauen.
Vom 15. bis 25. Februar 2024 fand, wie jedes Jahr, die Berlinale statt. Deutschlands größtes Filmfestival versucht seit Jahren, wenig erfolgreich, ein politisches Festival mit einer aufregenden Filmauswahl und bedeutenden Neuentdeckungen zu sein. Der vorjährige Gewinner der Sektion Panorama Dokumente war definitiv eine solche Neuentdeckung und zudem hoch politisch. Bei der Preisverleihung waren Basel Adra und Yuval Abraham zugegen. Die beiden sind nicht nur zwei der vier Filmemacher*innen (neben Rachel Szor und Hamdan Ballal), sondern ebenfalls die beiden Hauptpersonen des Dokumentarfilms. Bei seiner Dankesrede sagte der israelische Staatsbürger Yuval:
“In zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleich sind. Ich lebe unter einem zivilen Recht, Basel unter einem militärischen. Wir wohnen 30 Minuten voneinander entfernt, aber ich habe Stimmrecht und Basel hat kein Stimmrecht. Ich darf mich in dem Land frei bewegen, Basel ist wie Millionen Palästinenser eingeschlossen in der West-Bank. Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit muss ein Ende haben.“
Während Basel Adra folgendes sagte:
„Ich bin hier, um den Preis entgegenzunehmen, aber es fällt mir sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meiner Leute von Israel in Gaza abgeschlachtet und massakriert werden. Auch Masafer Yatta, meine Gemeinde, wird von israelischen Bulldozern niedergewalzt. Ich bitte Deutschland, da ich hier in Berlin bin, den Aufrufen der UN zu folgen und keine Waffen mehr nach Israel zu schicken.“
Offensichtlich war es einigen Parteifunktionär*innen und Hauptstadtjournalist*innen einen Tick zu politisch. Nach der Preisverleihung überschlugen sich die Stellungnahmen, wie diese vom regierenden Berliner Bürgermeister Kai Wegner (CDU):
„Das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen ist, war eine untragbare Relativierung. In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz, und das gilt auch für die Kunstszene. Ich erwarte von der neuen Leitung der Berlinale, sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen.“
Wegner hat mit dieser Aussage zwei Gemeinplätze bedient, eine äußerst dumme Aufforderung ausgesprochen und eine dreiste Behauptung aufgestellt. Für einen Regierungschef eine beachtliche Leistung. Dass Antisemitismus in Berlin und ganz Deutschland keinen Platz hat (oder haben sollte) und dass dies auch für die Kunstszene gilt, ist klar. Deshalb ist die Aufforderung an die Leitung der Berlinale nicht nur dumm, sondern auch anmaßend und zeigt, dass sich Wegner eine Kulturszene wünscht, die nicht um Demokratie und Streit bemüht ist, sondern nach der Pfeife der Staatsräson tanzt. Und damit sind wir bei der dreisten Behauptung. Die Gemeinplätze und der autoritäre Appell an die Berlinale folgen nur einer These, nämlich der, dass der Film und/oder die Dankesrede die Vorfälle vom 07. Oktober relativieren würden und damit antisemitisch seien.
Christian Goiny (CDU) sagte in einem rbb-Interview etwas ähnliches: „Die Festivalleitung hätte sicherlich bei der Moderation vorbereiteter sein müssen, dass politische Statements kommen und dass es eine Möglichkeit gibt darauf zu reagieren[…]“ Die Kulturjournalistin Maria Ossowski sagte dem rbb: „Alles was passiert ist, hat gezeigt, dass die Berlinale ein Riesenproblem hat, dass die ganze Kulturszene ein Riesenproblem hat, denn die Leute haben auch noch opportunistisch dazu geklatscht, ohne die andere Seite zu sehen.“
Versuchen wir, diese Behauptungen zu überprüfen. Der Satz von Basel Adra: „Ich bin hier, um den Preis entgegenzunehmen, aber es fällt mir sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meiner Leute von Israel in Gaza abgeschlachtet und massakriert werden“, dürfte dem Regierenden Bürgermeister von Berlin am meisten aufgestoßen sein. Schließlich wird nur an dieser Stelle das Leid der Palästinenser*innen im Gaza-Streifen angesprochen. Doch inwiefern diese Aussage eine Relativierung sein soll, bleibt Wegner schuldig. Würde es dem palästinensischen Filmemacher leichter fallen, einen deutschen Filmpreis anzunehmen, wenn er sich daran erinnern würde, dass die Hamas über 1000 Menschen getötet hat? Relativiert das Trauma des einen das Trauma der anderen? Was hier geschieht, ist, dass Wegner das Leid von einem persönlichen Anliegen auf eine politische Ebene hebt, um seine persönliche pro-israelische Position durchzubringen. In diesem einen Tweet kann man mehr Opportunismus erkennen als in jedem einzelnen Applaus im Berlinale Publikum.
Viel wichtiger noch ist der Schlusssatz aus Adras Rede: „Ich bitte Deutschland, da ich hier in Berlin bin, den Aufrufen der UN zu folgen und keine Waffen mehr nach Israel zu schicken.“ Da muss der deutsche Politiker schwer schlucken. Ein Künstler, der auch noch betroffen ist, beruft sich auf die UN, und fordert, dass keine Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt werden. Kai Wegner sollte sich vielleicht überlegen, ob er nicht derjenige ist, der hier die UN relativiert. Wollen wir wirklich einen Kulturbetrieb, in dem ein Appell an den gesunden Menschenverstand und das Völkerrecht mit den außenpolitischen Positionen einer Bundesregierung aufgewogen wird?
Das größte Versäumnis in der ganzen Debatte um diesen Film war, dass niemand über den Film diskutiert hat, sondern immer nur um ihn herum. Die Debatte pendelte zwischen ‚Wer ist schuld?‘ und ‚Darf man das?‘. Darüber geht verloren, was ein solches Kunstwerk ausdrücken kann. Wenn man einmal Filmkritiker*innen und Filmwissenschaftler*innen befragen würde, statt Hauptstadtpolitiker*innen und selbsternannte Kulturjournalist*innen, dann könnte man darüber reden, welche Perspektiven dieser Dokumentarfilm eröffnet und was er verhandelt. Und dann könnte man am Ende vielleicht ernsthaft die Frage beantworten: War das eine Relativierung oder gar antisemitisch? Und genau das werden wir jetzt tun.
Zunächst einmal: Was wird eigentlich gezeigt? »No Other Land« handelt von der Region Massafer Yatta, im Westjordanland. Basel Adra und seine Familie leben dort. Der Film zeigt die völkerrechtswidrige Vertreibung der dort lebenden Menschen und wie der israelische Staat dabei vorgeht. Er zeigt die Bulldozer, die die Häuser der Palästinenser*innen zerstören. Er zeigt israelische Soldat*innen, wie sie die lokale Bevölkerung in Schach halten, Demonstrationen auflösen oder israelische Siedler dulden. Die Gewalt der Siedler an den Palästinensern zeigt der Film auch.
Das Besondere des Films ist seine Erzählweise. »No Other Land« hat mehrere Perspektiven, die eingenommen werden. Da sind die beiden Hauptpersonen, Basel Adra und Yuval Abraham, sie filmen die Räumungen mit alten Camcordern. Diese Bilder sind niedrig aufgelöst, verwackelt und zeigen immer die Subjektiven der Akteure. Wir hören jederzeit die Worte der Kameramänner. Wie sie mit den Soldaten reden oder sie anschreien. Und wir können immer sofort die Reaktionen der Soldaten sehen. Das so vermittelte Bild ist also subjektiv. Wir sehen, wie Basel und Yuval die Welt sehen, wir sehen aber auch wie die Welt mit ihnen interagiert. Und diese Interaktionen sind sehr verschieden. Wir kommen gleich noch genauer darauf zu sprechen.
Dann haben wir noch eine weitere Erzählperspektive. Es gibt nämlich zwei weitere Filmemacher*innen, die nicht in Erscheinung treten und mit moderneren, höher aufgelösten Kameras die Dreharbeiten begleiten. Sie treten in die zweite Reihe und zeigen von hinten, wie die Hauptpersonen gerade filmen. Diese Perspektive funktioniert wie eine Erzählerebene. Es sind Momente, in denen wir nicht nur die Geschehnisse in Massafer Yatta sehen, sondern die zwei Filmemacher im Kontext der Geschehnisse. Mit diesem simplen wie genialen Kniff wird ein ganzes Netz aus Bedeutungen gewoben. Denn das Interessanteste am Film sind weder die Taten noch die Täter, sondern seine Protagonisten.
Yuval Abraham hat einen israelischen Pass und Basel Adra einen palästinensischen. An einer Stelle im Film spricht Yuval über die Autos im Westjordanland. Sie haben zwei unterschiedliche Nummernschilder. Die Nummernschilder der Palästinenser sind grün, die der Israelis sind gelb. Die gelben Nummernschilder dürfen das Westjordanland verlassen, die grünen nicht. Die grünen Nummernschilder werden viel häufiger kontrolliert als die gelben und es gibt Straßen, auf denen nur Autos mit gelbem Kennzeichen fahren dürfen. Auch Basel und Yuval sind gewissermaßen gelb und grün. Basel ist stigmatisiert. Er wird von den Soldaten angefeindet und geschubst, auf zwei seiner Verwandten wird aus nächster Nähe geschossen. Wenn Yuval auf den Plan tritt, verändert sich die Situation. Die Soldaten sind vorsichtiger mit dem Israeli. Nur wenige Male kommt es zu Szenen, in denen Yuval als „Verräter“ beschimpft wird. Es fallen Sätze wie „Das ist ein Jude, der ihnen hilft“. Es ist wichtig festzustellen, dass der Film diese Trennung niemals direkt benennt. Lediglich die darin vorkommenden Personen lassen uns vermuten, wie sehr die Lager gespalten sind. Der Film zeigt uns, dass hier nichts mehr offen ausgesprochen werden muss, weil es für die Beteiligten, den Staat, das Militär, die Abrissfirmen, die Siedler, die Palästinenser*innen schon längt klar ist. Es gibt im Westjordanland einen verheerenden Unterschied zwischen Menschen mit einem grünen und Menschen mit einem gelben Nummernschild, mit einem palästinensischen und einem israelischen Pass. Wie man dieses System nennen möchte, bleibt dem Zuschauer selbst überlassen.
Bleiben wir bei der Bildsprache. Dieser Dokumentarfilm macht vieles besser als die meisten seiner Genrekollegen. Er lässt immer wieder Raum für poetische Bilder. Bilder, in denen wir ein ganzes Universum an Bedeutungen entdecken können. Bilder, die mehr zeigen, als Worte sagen können: Die palästinensische Bevölkerung demonstriert gegen ein Bauverbot der israelischen Regierung. Die ganze Familie hält Transparente mit der Aufschrift „Palestinian lives matter“ und schwarzen Luftballons in den Händen. Plötzlich löst das Militär die Versammlung auf. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, die alle aus der Subjektiven gefilmt werden. Doch plötzlich löst sich die Kamera vom Geschehen. Ein Bündel Luftballons wird von einem Kind losgelassen und fliegt davon. Wir sehen den Ballons noch lange nach, während die Gewalt am Boden weitergeht.
Ein anderes Mal kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen der Zivilbevölkerung und den Soldaten. Das Militär will einen Generator beschlagnahmen, der das ganze Dorf mit überlebenswichtigem Strom versorgt. Im Kreis stehen die Männer um den kleinen Generator, sie brüllen sich an, draußen schreien einige Frauen und Kinder. Immer wieder versuchen die Dorfbewohner, den Generator zu packen, doch dann zerren die Soldaten schon wieder daran. So entsteht eine fast tänzerische Choreographie. Nicht selten wird uns die karge, steinige Landschaft gezeigt. Wir sehen das Westjordanland, diese fast wüstenähnliche Landschaft, in der sicher nicht viel angebaut werden kann, höchstens ein paar Ziegen weiden. Dennoch wirken diese Landschaften schön und fremd zugleich, weil ihre eigenartige Schönheit mit der Absurdität der Gewalt zusammenfällt. Warum werden hier Menschen vertrieben? Menschen, die, wie sie selbst sagen, seit dem 19. Jahrhundert in Masaffer Yatta leben. Menschen, von denen die israelische Regierung sagt, sie hätten kein Recht, hier zu leben.
Zurück zu den beiden Hauptfiguren. Indem der Film immer wieder aus der Ich-Perspektive in die Erzählperspektive wechselt, wird nicht nur das Leben der palästinensischen Bevölkerung geschildert, sondern auch die innige Beziehung von Basel und Yuval. Obwohl sie nicht aufgeben und ihre ganze Zeit dem Aktivismus widmen, fällt es vor allem Basel schwer, optimistisch zu sein. Seine Zukunft wird von einem Staatsapparat bedroht, dem man mit bloßem Aktivismus nicht beikommen kann. Basel ist die ganze Zeit am Handy, postet seine Videos in sozialen Netzwerken und stellt immer wieder fest, wie wenig sich die Menschen für das Geschehen interessieren. Trotzdem machen sie weiter und filmen alles. Denn sowohl ihr Aktivismus als auch der daraus entstandene Film zeigen, welche Macht und Bedeutung Bilder entwickeln können. Sie tun nichts anderes, als den Abriss von Dörfern in der Westbank zu dokumentieren. Das ist eigentlich eine sehr passive Arbeit. Selten greifen sie ein, viel öfter müssen sie sich verteidigen, um nicht vom Militär vertrieben zu werden. Gleichzeitig erfahren wir, dass sich die Öffentlichkeit nicht für diese Bilder interessiert. Wie absurd diese Situation wird, zeigt der Film, als der damalige britische Premierminister Tony Blair nach Massafer Yatta kommt. Er hat mehrere Fernsehteams dabei, die alles filmen. Auch Basel ist dabei und filmt den Besuch. Am Tag nach dem Besuch hebt die israelische Regierung das Bauverbot im Dorf auf. Dem Zuschauer wird klar, wie sehr die Wirkung der Bilder davon abhängt, wer filmt.
Die Medien, aber auch die Algorithmen der sozialen Netzwerke lassen die Stimmen der Palästinenser*innen ganz bewusst ungehört verhallen. Daher ist die Kritik, der Film zeige eine einseitige Perspektive und relativiere die Situation im Nahen Osten, nicht berechtigt. Dieser Film nimmt eine persönliche, subjektive Position ein, aus der er beobachtet, spricht und Reaktionen dokumentiert. Diese Perspektive zu zeigen, sollte die wichtigste Aufgabe eines Filmfestivals und eines Kulturbetriebs sein. Deshalb müssen wir feststellen, dass die Reaktionen nach der Dankesrede auf der Berlinale offensichtlich nicht an einer pluralistischen Diskussion interessiert sind, sondern diese ohnehin schon marginalisierten Stimmen weiter unterdrücken wollen. Die Stimmen aus Politik und Journalismus folgen den Stimmen des israelischen Staates. Denn im Film sehen wir, dass die Soldaten ab einem gewissen Punkt auch Kameras mitführen. Sie filmen nun Basel und Yuval und wollen damit die Deutungshoheit an sich reißen. Der Kampf um Freiheit in der Westbank ist vor allem ein Kampf um mediale Repräsentation.
Bei der Oscarverleihung 2025 waren Basel und Yuval erneut zugegen. Yuval erneuerte seinen Appell und erklärte, dass die US-Regierung aktiv daran arbeitet, den Weg zu einer friedlichen Zweistaatenlösung zu behindern. Auch dieses Publikum applaudierte.
Der Dokumentarfilm »No Other Land« zeigt eine brutale Welt, in der Menschen in ethnische Gruppen eingeteilt werden. Er zeigt weiterhin, wie nicht nur die Lebensgrundlagen der Palästinenser*innen unterdrückt werden, sondern auch ihre Stimmen. Der Film tut dies mit großer künstlerischer Qualität. Dieser Film muss gesehen werden, weil er eine unerhörte Perspektive zeigt, die sonst verloren ginge. Aber vor allem, weil er filmisch großartig gemacht ist. »No Other Land« hat nicht nur den Dokumentarfilmpreis der Berlinale, sondern auch die Oscar-Nominierung, mehr als verdient. Wer denkt, dass dieser Film nichts zu bieten hat außer eines simplen politischen Statements und in diesem Sinne nur pro-palästinensische Propaganda sei, hat nichts verstanden und sollte sich lieber von der Institution Kino fernhalten.
Tobias, Kinoliebhaber und leidenschaftlicher Film-Festival Gänger, studiert in Hannover Germanistik und Hispanistik und engagiert sich seit 2023 im SDS.